Bruce H. Lipton
Der Honeymoon Effekt
Liebe geht durch die Zellen
Aus dem Amerikanischen von Nayoma de Haen
Originaltitel: The Honeymoon-Effect
Orginal Verlag: Hay House
Hardcover, 186 Seiten, 14 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-86728-211-6
Erschienen am: 10.1.2003
Lieferstatus: Dieser Titel ist lieferbar
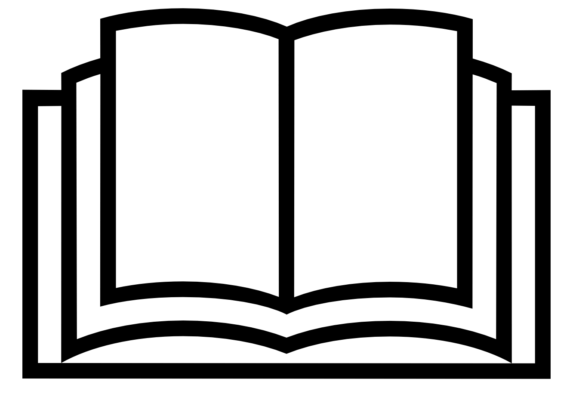
Der Honeymoon-Effekt
16,95 €
inkl. MwSt.
Bruce Lipton erklärt auf seine wundervoll einprägsame, leicht verständliche und amüsante Art mit Hilfe der Zellbiologie, der Quantenphysik und der Neurologie, wie wir das herrliche Gefühl der Flitterwochen dauerhaft in unsere Beziehungen holen können. Jede Zelle strahlt Energie aus – also auch jeder Einzelne von uns –, und ihre Frequenz hat erheblichen Einfluss darauf, was in unserem Leben geschieht. Und was bestimmt die Frequenz unserer Energie?
Unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein. In einer Paarbeziehung also vier unterschiedliche Bewusstsein mit jeweils eigenen Zielen, Absichten und Programmen.
Neben Einblicken in die persönliche glückliche Liebesgeschichte mit seiner Partnerin Margaret gibt Lipton konkrete Hinweise, was wir tun können, um den Honeymoon-Effekt in unserem Leben zu etablieren.
Leseprobe:
Hätte mir in jungen Jahren irgendjemand gesagt, ich würde einmal ein Buch über Beziehungen schreiben, hätte ich ihn für ver-rückt erklärt. Meiner Ansicht nach war die Liebe etwas, das sich Dichter und Hollywood-Produzenten ausgedacht hatten, damit sich die Leute nach etwas sehnen, was sie nie bekommen werden. Ewige Liebe? Glücklich für alle Zeit? Vergiss es!Wie die meisten Menschen wurde ich so programmiert, dass sich manches in meinem Leben problemlos ergab. Meine Programmie-rung setzte vor allem auf Bildung. Nach Meinung meiner Eltern machte Bildung den Unterschied zwischen einem harten Dasein als Straßenarbeiter und einem bequemen Leben als Krawattenträ-ger aus. Sie waren davon überzeugt, ohne Bildung könne man es im Leben zu nichts bringen. Daher überrascht es nicht, dass es unsere Eltern in Bezug auf Bildung an nichts mangeln ließen. Ich erinnere mich noch gut an jenen Tag in meinem zweiten Schuljahr, als ich aufgeregt aus Mrs. Novaks Klasse nach Hause lief. Ich hatte meinen ersten Ein-blick in die erstaunliche mikroskopische Welt der Amöben und der wunderschönen einzelligen Algen mit dem faszinierenden Namen Spirogyra erhalten. Ich platzte fast vor Begeisterung und bat meine Mutter inständig um ein eigenes Mikroskop. Ohne zu zögern, fuhr sie noch am selben Tag los, um mir mein erstes Mikroskop zu kaufen. Kein Vergleich zur Reaktion meiner Mutter auf mei-nen verzweifelten Wunsch, einen Roy-Rogers-Cowboyhut, einen Trommelrevolver und einen Revolvergürtel zu bekommen!Trotz meiner Roy-Rogers-Phase wurde Albert Einstein zum konkurrenzlosen Helden meiner Jugend. Ich liebte die Bilder von ihm, auf denen er mit wirrem weißem Haarschopf der Welt die Zunge herausstreckt. Ich liebte es auch, Einstein auf dem winzi-gen Bildschirm des kürzlich erfundenen Fernsehers in unserem Wohnzimmer zu sehen, wo er wie ein liebevoller, weiser, verspielter Großvater wirkte. Ich war vor allem stolz darauf, dass Einstein, ein jüdischer Immigrant wie mein Vater, durch seine wissenschaftliche Brillanz alle Vorurteile außer Kraft setzte.
In Westchester County im Staat New York, wo ich aufwuchs, fühlte ich mich oft wie ein Aussät-ziger. Es gab Eltern, die ihren Kindern verboten, mit mir zu spie-len, weil ich sie mit »Bolschewismus« infizieren könnte. Es machte mich stolz und gab mir Sicherheit, zu wissen, dass Einstein als Jude überhaupt nicht ausgeschlossen, sondern international geachtet und geehrt wurde.Gute Lehrer, meine bildungsbesessene Familie und meine Lei-denschaft dafür, Stunden am Mikroskop zu verbringen, führten schließlich zu einem Doktortitel in Zellbiologie und einer festen Stelle an der University of Wisconsin School of Medicine. Doch erst als ich die University of Wisconsin verließ, um die »neuen Wissenschaften« mitsamt der Quantenmechanik zu erkunden, begann ich, die eigentliche Bedeutung des Beitrags meines Jugend-helden Einstein zu ermessen.Während meine akademische Lauf bahn florierte, war ich in ande-ren Bereichen meines Lebens ein Vorbild der Dysfunktionalität, vor allem im Bereich der Beziehungen. Ich heiratete in meinen Zwanzigern, als ich für eine sinnerfüllte Beziehung noch viel zu jung und emotional unreif war. Als ich nach zehn Jahren Ehe mei-nem Vater erklärte, wir würden uns scheiden lassen, hielt er vehe-ment dagegen: »Eine Ehe ist ein Geschäft!«Für jemanden, der 1919 aus dem von Pogromen, Hungersnot und Revolution geschüttelten Russland emigriert war, erscheint mir diese Reaktion im Rückblick verständlich. Für meinen Vater und seine Familie war das Leben unvorstellbar hart gewesen. Immer ging es ums Überleben. Kein Wunder, dass eine Ehe für meinen Vater eine Arbeitsbeziehung war, ähnlich den »Bräuten auf Bestellung«, die die Pioniere im Wilden Westen des 19. Jahrhun-derts per Post orderten. Die Ehe meiner Eltern spiegelte diese geschäftsorientierte Hal-tung meines Vaters wider, obwohl meine in den USA geborene Mutter seiner Philosophie nicht anhing. Meine Eltern arbeite-ten sechs Tage die Woche in einem erfolgreichen Familienunter-nehmen zusammen, ohne dass irgendeines ihrer Kinder sich an einen Kuss oder irgendeine romantische Geste erinnern könnte.

Bruce Lipton ist international für seine Art bekannt, Wissenschaft und Geist miteinander zu verbinden. Als Zellbiologe lehrte er an der medizinischen Fakultät der Universität von Wisconsin und arbeitete als Forscher an der medizinischen Fakultät der Stanford Universität. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse über die Zellmembran machten ihn zu einem Pionier der neuen Wissenschaft der Epigenetik. Heute reist er durch die ganze Welt und hält Vorträge und Seminare über die Neue Biologie.
WEITERE PRODUKTE DES AUTORS:
Presse: >>>
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Koha Verlag GmbH, St. Sebastian 13, 84405 Dorfen, http://www.koha-verlag.de
Verantwortliche Person in der EU
Konrad Halbig, info@koha-verlag.de














